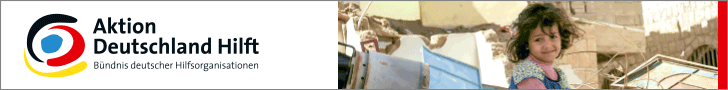Klimawandel wirkt auf Pflanzen-Gene

Der Klimawandel setzt Lebewesen unter Stress. Sowohl der Wandel in den durchschnittlichen Lebensbedingungen, als auch die Zunahme an extremen Ereignissen wirken sich auf Organismen aus. Welchen Einfluss insbesondere Klimaextreme auf Seegräser haben, untersuchten Wissenschaftler der Christian-Albrechts Universität zu Kiel, der Universität Münster und des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften. Ihre Ergebnisse erscheinen jetzt online in der renommierten Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).
Seegraswiesen säumen weltweit die flachen Küstenregionen und bieten einen idealen Lebensraum für viele Fische, Krustentiere und andere Kleinlebewesen. Der weltweite Rückgang der Seegraspopulationen in den vergangenen Jahren wird daher von Wissenschaftlern mit großer Besorgnis betrachtet. Eine wichtige Rolle dabei könnte der Klimawandel spielen. Beobachtungen zeigen, dass vor allem häufigere Extremereignisse wie zum Beispiel Hitzewellen dem Seegras zu schaffen machen.
Die Wissenschaftler um Professor Dr. Thorsten Reusch befassten sich dabei mit der Frage, ob sich Hitzewellen auch auf die Genregulation des gewöhnlichen Seegrases (Zostera marina) auswirken. „Im Mittelmeer überstehen Seegräser dieser Art wesentlich höhere Temperaturen, als in den heimischen Gewässern Nord- und Ostsee. Hier sind die Seegrasbestände durch im Sommer auftretende Hitzewellen bei Wassertemperaturen über 25°C stark gefährdet“, erläutert der Kieler Ökologe die Hintergründe der Untersuchungen. Die Anpassungsfähigkeit an Hitze scheint eine genetische Basis zu haben, die die Forscher entschlüsseln wollten. Für die Analyse sammelten die Doktorandinnen Susanne Franssen und Nina Bergmann Seegräser an verschiedenen Standorten in Nord- und Südeuropa und setzten diese in einer speziellen Versuchsanlage kontrollierten Hitzewellen aus. Anschließend untersuchten die Forscher die Aktivität fast aller Gene der Pflanzen.
Überraschenderweise aktivierten alle Pflanzen Gene, die Hitzestress abfangen können, egal ob sie aus Nord- oder Südeuropa stammten. Während die südeuropäischen Pflanzen jedoch sofort nach der Hitzewelle wieder eine normale Genaktivität zeigten, wiesen die nordeuropäischen Pflanzen unumkehrbare Schädigungen auf. Offensichtlich entscheidet sich also erst in der Erholungsphase nach der Hitzewelle, ob eine Pflanze weiter wächst oder dauerhaft geschädigt bleibt. Um Voraussagen zur Anpassungsfähigkeit von Organismen an Extremereignisse wie Hitzewellen zu treffen, scheint daher die Untersuchung der Genaktivität in der Erholungsphase besser geeignet zu sein.
Most Wanted

Sarah Baker Foto: LLL/flickr CC
Hoffnung für den Klimaschutz
Wissenschaftler am Lawrence Livermore Forschungslabor haben nicht nur den Schlüssel gefunden, mit...

Foto: Pixabay CC/PublicDomain/Pexels
Kehrseite des Sportevents: Tonnenweise Essensmüll
Superbowl: In der Nacht des Football-Endspiels der besten Teams verzehren die Zuschauer – im...

Foto: Pixabay CC/PublicDomain/Arek Socha
Neuer Ansatz für Ökoenergie: Strom aus Wassertropfen
Neue, Idee für die Energiewende: Wissenschaftler der City University Hongkong entwickelten einen...
Neu im global° blog
Foto: Pressenza (CC BY 4.0)
Atomwaffen verstoßen gegen das Recht auf Leben
Die Organisationen IALANA, IPPNW und ICAN weisen anlässlich des Tages der Menschenrechte auf den...

Foto: ZDF / Martin Kaeswurm
"Schattenmacht Blackrock"
Der amerikanische Finanzinvestor Blackrock verwaltet im Auftrag seiner Kunden über sechs Billionen...

Screenshot: gunther-moll.de
Die Botschaft
Eine lebenswerte Zukunft im Einklang mit der Natur ist auf diesem Planeten möglich, wenn wir uns...