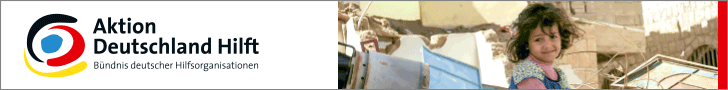Saure Meere als Folge des Klimawandels

- Brandung des Ozeans Foto: Wikimedia CC 3.0/FelixaNeu
Sie ist der böse Zwilling der Klimaerwärmung: die Ozeanversauerung. Damit wird sie natürlich auch im neuen Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) zum Thema, wie der Spiegel berichtet.
Die Ozeane binden jährlich mehr als ein Viertel des Kohlenstoffdioxids, das die Menschheit freisetzt. Das gelöste CO2 reagiert mit dem Wasser und wird zu Kohlensäure. Diese kann Wasserstoff-Ionen, so genannte Protonen abgeben, wodurch der pH-Wert des Wassers sinkt. Es versauert.
Normalerweise ist das Meerwasser mit einem pH-Wert von 8,2 leicht basisch. Seit Beginn der Industrialisierung ist dieser Wert jedoch auf 8,1 gesunken, berichtet das Alfred-Wegener-Institut, Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Das klingt nicht nach einer großen Veränderung. Doch die Senkung des pH-Werts um 0,1 wirkt sich stark auf das Meerwasser aus. Es wird um 30 Prozent saurer.
Der UNO-Klimarat warnt: Zahlreichen Organismen falle es inzwischen schwerer, ihre Schalen, Skelette oder Gehäuse aufzubauen. Da Kleinstlebewesen mit ihren Kalkskeletten eine Basis der Nahrungskette bilden, ginge mit ihrem Verschwinden auch die Lebensgrundlage vieler größerer Meeresbewohner verloren.
Neben dem Nahrungsproblem hat der Kohlendioxid-Gehalt im Wasser auch direkt Auswirkungen auf Fische. Forscher fanden heraus, dass gerade junge Fische sensibel auf einen niedrigeren PH-Wert reagieren. Während ausgewachsene Exemplare sich gut an wechselnde Kohlendioxidkonzentrationen im Wasser anpassen können, sind die Mechanismen, die dafür zuständig sind, bei jungen Fischen und Fischlarven noch nicht ausgereift.
Pflanzen profitieren von erhöhter CO2-Konzentration
Nicht alle Angehörigen des Ökosystems Meer jedoch leiden unter einer höheren Kohlendioxidkonzentration. „Die meisten Pflanzen, inklusive Algen, reagieren zunächst positiv auf erhöhte CO2-Menge“, heißt es im Report der Vereinten Nationen. Pflanzen betreiben ihren Stoffwechsel aus CO2 und Sonnenlicht. Daher profitieren sie eher von der Zufuhr des Treibhausgases.
Wie sich ein weiterer Anstieg des CO2-Gehaltes und damit ein weiteres Absinken des PH-Werts im Meerwasser auf das gesamte Ökosystems auswirken würde, ist ungewiss. Experimente bilden meist nicht exakt die realen Bedingungen ab, außerdem handelt es sich um ausschnitthafte Momentaufnahmen. Viele Forscher vertreten die so genannte Nullhypothese, sie glauben, dass die meisten biologischen Prozesse vom Wandel unberührt bleiben. Sie aber haben auch viele Gegenstimmen. Spiegel-Online zitiert Ulf Riebesell vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel: „Wir wissen nicht genau, was geschehen wird. Aber sicher ist, der Ozean wird sich verändern, und negative Folgen sind zu erwarten.“KAM
Lesen Sie auch:
Küsten in Gefahr – Abhilfe durch Einzeller?
Most Wanted

Sarah Baker Foto: LLL/flickr CC
Hoffnung für den Klimaschutz
Wissenschaftler am Lawrence Livermore Forschungslabor haben nicht nur den Schlüssel gefunden, mit...

Foto: Pixabay CC/PublicDomain/Pexels
Kehrseite des Sportevents: Tonnenweise Essensmüll
Superbowl: In der Nacht des Football-Endspiels der besten Teams verzehren die Zuschauer – im...

Foto: Pixabay CC/PublicDomain/Arek Socha
Neuer Ansatz für Ökoenergie: Strom aus Wassertropfen
Neue, Idee für die Energiewende: Wissenschaftler der City University Hongkong entwickelten einen...
Neu im global° blog
Foto: Pressenza (CC BY 4.0)
Atomwaffen verstoßen gegen das Recht auf Leben
Die Organisationen IALANA, IPPNW und ICAN weisen anlässlich des Tages der Menschenrechte auf den...

Foto: ZDF / Martin Kaeswurm
"Schattenmacht Blackrock"
Der amerikanische Finanzinvestor Blackrock verwaltet im Auftrag seiner Kunden über sechs Billionen...

Screenshot: gunther-moll.de
Die Botschaft
Eine lebenswerte Zukunft im Einklang mit der Natur ist auf diesem Planeten möglich, wenn wir uns...