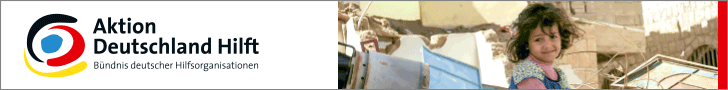Die vergessenen Aussteiger der Biobranche

- Foto: Bioland
Es ist nicht alles Gold, was glänzt- auch nicht auf dem deutschen Biomarkt. Zwar boomt er nach wie vor, zwar hat sich die Zahl der Öko-Landwirte seit 1990 versiebenfacht, die bewirtschaftete Fläche gar verzwölffacht. Was dabei jedoch gerne übersehen wird: Hinter dieser Statistik verbirgt sich auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Aussteigern.
Laut einer jetzt veröffentlichten Studie des Thünen-Instituts in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel geht ein Neueinstieg in die ökologische Landwirtschaft mit 0,2 Betriebsaufgaben und 0,4 Rückumstellungen auf konventionelle Bewirtschaftung einher. Das entspricht im Zeitraum zwischen 2003 und 2010 1,4 Prozent Aufgaben und 3,3 Prozent Umstellungen. Eine Tatsache, die bislang meist völlig übersehen wird: Weltweit stießen die Autoren der Studie auf gerade einmal 15 andere Veröffentlichungen zu den „verlorenen Schafen“ unter den Ökobauern.
Bio ist keine Grundsatzentscheidung
Für viele Landwirte ist die Umstellung auf Bio keine unumstößliche Grundsatzentscheidung, vielmehr knüpfen sie vielfältige, vor allem ökonomische Erwartungen an die Veränderung. Weil viele Bioproduzenten sich nach Ansicht der Autoren mit völlig falschen Vorstellungen ins Öko-Geschäft stürzen, rät die Studie zu einer obligatorischen Erstberatung für Neueinsteiger. Dies erscheint in der Tat sinnvoll, da Landwirte, die auf externe Beratung zurückgriffen, viel seltener aufgaben als diejenigen, die sich alleine durchschlugen. Auch wer sich einem ökologischen Anbauverband anschloss, blieb der Ökoproduktion häufiger treu als die Vergleichsgruppe.
Obgleich Ökobetriebe im Schnitt höhere Einkommen erzielen als ihre konventionellen Gegenstücke, empfanden viele Betriebsleiter den Verdienst als zu niedrig, was sie als Grund für die Umstellung angaben. Zudem beklagten die Aussteiger zu komplizierte und strenge Ökorichtlinien sowie den hohen Zeit- und Geldaufwand für Kontrollen und Nachweise der Bioqualität. Produktionstechnische Probleme wie Unkrautbekämpfung oder stark schwankende Erträge spielten hingegen, insbesondere bei den kleineren Betrieben, erst die zweite Geige.
Auch „Bio zur falschen Zeit am falschen Ort“- sprich, fehlende Absatzmärkte für die eigenen Produkte- spielte eine Rolle. Verschärfte Richtlinien wie „100 Prozent Biofütterung“ verursachten zudem Zusatzkosten, die vom Biomarkt jedoch preislich nicht honoriert würden.

- Foto: Bioland
“Rück-Rück-Umstellung“ denkbar
Den typischen Grund für den Ausstieg gab es nicht; meist spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Die meisten Landwirte gaben jedoch an, sich eine „Rück-Rück-Umstellung“ vorstellen zu können. Zu ihren Voraussetzungen zählten dabei weniger Bürokratie, niedrigere Kontrollkosten, höhere Preise für Ökoprodukte und verlässlichere Fördergelder.
Festzuhalten bleibt: Je länger ein Biobetrieb „lief“, desto eher blieb er dem Bioprinzip auch treu. Der Staat könnte sich also überlegen, wie er insbesondere Neulingen den Einstieg ins Ökogeschäft erleichtern kann. Schließlich ist der kontinuierliche Ausbau des Ökolandbaus hierzulande erwünscht- aber dafür braucht es neben mehr Einsteigern auch weniger Aussteiger. NISO
Lesen Sie auch:
Bioland-Bauern positionieren sich “gegen Rechts”
Most Wanted

Sarah Baker Foto: LLL/flickr CC
Hoffnung für den Klimaschutz
Wissenschaftler am Lawrence Livermore Forschungslabor haben nicht nur den Schlüssel gefunden, mit...

Foto: Pixabay CC/PublicDomain/Pexels
Kehrseite des Sportevents: Tonnenweise Essensmüll
Superbowl: In der Nacht des Football-Endspiels der besten Teams verzehren die Zuschauer – im...

Foto: Pixabay CC/PublicDomain/Arek Socha
Neuer Ansatz für Ökoenergie: Strom aus Wassertropfen
Neue, Idee für die Energiewende: Wissenschaftler der City University Hongkong entwickelten einen...
Neu im global° blog
Foto: Pressenza (CC BY 4.0)
Atomwaffen verstoßen gegen das Recht auf Leben
Die Organisationen IALANA, IPPNW und ICAN weisen anlässlich des Tages der Menschenrechte auf den...

Foto: ZDF / Martin Kaeswurm
"Schattenmacht Blackrock"
Der amerikanische Finanzinvestor Blackrock verwaltet im Auftrag seiner Kunden über sechs Billionen...

Screenshot: gunther-moll.de
Die Botschaft
Eine lebenswerte Zukunft im Einklang mit der Natur ist auf diesem Planeten möglich, wenn wir uns...