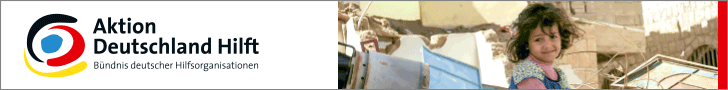Mehr Schutzgebiete für die Meere

- Foto: flickr/Reisezeiten
Den Artenschützern des WWF liegen vor allem die maritimen Ökosysteme am Herzen. „Vor zwei Jahren“, so die Frankfurter Naturschutz-Stiftung, „verständigten sich die CBD-Vertragsstaaten darauf, bis 2020 mindestens zehn Prozent der Weltmeere unter Schutz zu stellen.“ Bis heute sei aber kaum wirklich etwas geschehen.
Nur 1,6 Prozent der Ozeane sind Schutzgebiete
Derzeit umfassten die Meeresschutzgebiete lediglich 1,6 Prozent der globalen Ozeane. „Die Weltmeere sind den Interessen von Fischerei, Rohstoffförderung und Tourismus noch immer weitgehend schutzlos ausgeliefert“, kritisiert Tim Packeiser, der Referent des WWF für Marine Ökoregionen.
In den zurückliegenden Jahren hätten Wissenschaftler, schreibt der WWF in einer Pressemeldung, bereits für das Mittelmeer, die Karibik, den West-Atlantik und den Süd-West-Pazifik Regionen mit herausragender ökologischer oder biologischer Bedeutung identifiziert. Diese Gebiete gelte es nun „unbedingt zu schützen“.
Europäischen Kampagne für Unternehmensverantwortung und Biodiversität
Warum ist der Schutz der Biodiversität wichtig für Unternehmen? Anhand eines Unternehmerbeispiels erklärt die Europäische Business & Biodiversity Kampagne wie Unternehmen von der Biodiversität profitieren und wie sie zum Schutz dieser beitragen können. Zunächst werden mögliche Probleme und Risiken dargestellt, wenn das Unternehmen kein Biodiversitätsmanagement betreibt. In einem nächsten Schritt werden Lösungsvorschläge für die jeweiligen Probleme aufgezeigt. Das von der simpleshow grafisch animierte Video zeigt einerseits die Einwirkungen, die Unternehmen auf die Umwelt haben und andererseits die von den Ökosystemen bestehenden Abhängigkeiten der Unternehmen.
Illegaler Handel mit geschützten Arten im Web

Foto: photocase/Nadim.LB
Fluch der Moderne: Auch Tier-Schmuggler gehen offenbar mit der Zeit. Indische Artenschützer und Computer-Spezialisten kamen jetzt einer neuen Art des illegalen Wildtier-Handels auf die Schliche: Sie schätzen dass inzwischen über fast 1.000 Seiten im Internet, Wilderer oder Hehler bedrohte Tiere zum Verkauf anbieten.
Biodiversität: Für viele noch immer ein Fremdwort

Logo: EBBC
Biodiversität? Nicht einmal jeder Zweite in Deutschland weiß Bescheid! Das Biodiversitäts-Barometer zeigt ein düsteres Bild: Hinter Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den USA, Brasilien oder China rangieren die Menschen in Deutschland mit nur 48 Prozent, die den Begriff kennen, als Schlusslicht der von der Union for Ethical BioTrade (UEBT) in Auftrag gegebenen Studie.
Klick in die Vielfalt 2013 – Mensch und Natur

Ziel des Fotowettbewerbes ist es, auf die vielfältigen Beziehungen des Menschen von der biologischen Vielfalt aufmerksam zu machen und für einen bewussten Umgang zu werben
Kreative Naturfotograf(innen) sind eingeladen, sich ab dem 1. Mai 2013 an dem Fotowettbewerb zur UN-Dekade Biologische Vielfalt „Klick in die Vielfalt 2013 – Mensch und Natur“ zu beteiligen. Eingereicht werden können Fotos, die das Miteinander von Mensch und Natur beleuchten.[mehr]
Bunte Landschaften – Garanten für Artenvielfalt

Foto: wikimedia commons/ M. Abegglen
Strukturreiche Landschaften neutralisieren die Isolation von Lebensräumen. Je bunter und abwechslungsreicher eine Gegend ist, desto artenreicher sind die einzelnen Biotope. Große Äcker, im schlimmsten Fall mit Monokulturen, sehen dagegen nicht nur öde aus, auf ihnen und den angrenzenden Wiesen ist auch nicht viel los.
Reptilien beim Artenschutz vernachlässigt

Foto: Wikipedia Commons/Tamar Assaf
Krokodile und Schlangen werden beim Artenschutz links liegengelassen. Während für den knuffigen Panda oder den anmutigen Tiger zahlreiche Hilfsprojekte existieren, kräht kein Hahn nach Schutzprogrammen für bedrohte Reptilienarten. Das ist ungerecht! Hat diese Tiergruppe denn keinen Anspruch auf Schutz, bloß weil sie nicht so „süß“ sind, wie Panda & Co?
US-Kongress: Wert der Natur

- Logo: ESA
Chancen und Risiken einer Quantifizierung der Dienstleistung von Ökosystemen diskutieren die Teilnehmer bei der 97. Jahrestagung der Ecological Society of America im Oregon Convention Center von Portland. Beim Treffen im August debattieren Anhänger und Kritiker über den ökonomischen Wert der Natur und der Arten und versuchen ein Handelssystem mit derlei Naturkapital zu erarbeiten.
„Was wir nicht in Dollar oder Euro bemessen, ist anscheinend nichts wert“, sagt Bobby Cochran, „dann nehmen politische Entscheider diese Güter nicht so wichtig.“ Er vertritt die Befürworter des 2005 von der UNO als Ecosystem Assessment propagierten Weges.
„Messen wir den Dinge einen Geldwert zu, dann sind sie auch für Ökonomen berechenbar.“
Emily Bernhardt von der Duke University ergänzt: „Ökosysteme versorgen uns mit vielfältigen Gütern, aber nicht alle sind dabei leicht zu quantifizieren.“ Sie erkennt auch die Crux des Systems: „Es gibt in der Natur zu viele Wechselwirkungen, deren Beziehungsgeflecht nur äußerst schwer zu benennen und noch schwerer zu beziffern ist.“